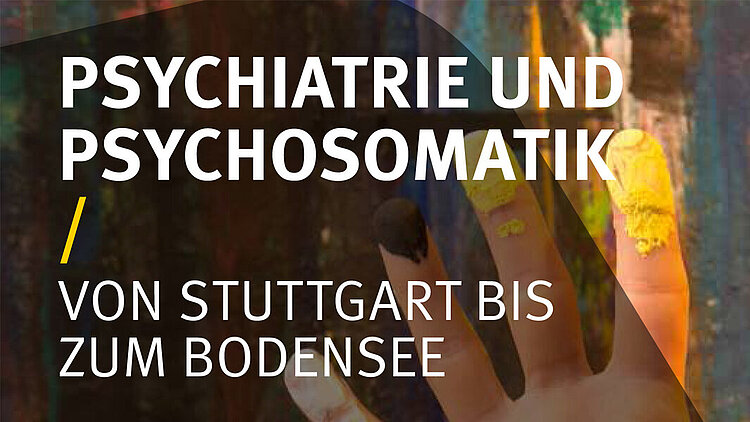Wie inklusiv sollte ein Museum sein, wie kann Inklusion künstlerisch gelingen und inwiefern wirkt der Kunst-Begriff ausgrenzend? Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Inklusiven Ateliers lud das ZfP Südwürttemberg zum Symposium „Psyche – Kunst – Inklusion“ ein.
Nach der Begrüßung durch Dr. Raoul Borbé, Geschäftsbereichsleiter Gemeindepsychiatrie der ZfP-Region Ravensburg-Bodensee, beschäftigte sich Sabine Mücke in ihrem Vortrag damit, wie inklusive Museumsarbeit aussehen kann und welcher Veränderungen es dafür bedarf. Die Direktorin des Museums Humpis-Quartier und Präsidentin des Museums-Verbands Baden-Württemberg führte aus, inwiefern sich die Institution Museum „im Dienst der Gesellschaft“ einem Wandel unterziehen sollte. Die unterschiedlichen Besucherinnen und Besucher würden nicht mehr nur als Rezipienten und Lernende angesehen, für die unterschiedliche Angebote und Formate bereitgehalten sowie pädagogische Materialien und spezifische Medien zur Verfügung gestellt werden, sondern: „Die Museen versuchen konsequent, die Publikumsperspektive einzunehmen, und zwar nicht aus der Sicht spezifischer Zielgruppen, sondern hinsichtlich grundlegender menschlicher Bedürfnisse: Alle sollen sich wohl und willkommen fühlen.“
Damit diese Neuausrichtung gelingen kann, seien diverse Voraussetzungen zu erfüllen: „Inklusion muss als Querschnittsaufgabe begriffen und nicht nur in der Museumspädagogik bearbeitet werden. Dazu müssen die Repräsentationsformen und die Arbeitsstrukturen insgesamt hinterfragt und verändert werden.“ Dies stelle unter anderem deutlich vielfältigere Anforderungen an das Personal als im klassischen Museum. Mücke: „Neben Fachwissenschaftlern und Museologinnen braucht es zum Beispiel auch Sozialpädagogen, Kommunikationswissenschaftlerinnen, Kunsterzieher oder Umweltpädagoginnen.“ Zielführend in der konzeptionellen Entwicklung seien nicht zuletzt das Einbeziehen von „Betroffenen“ als Experten in eigener Sache sowie die Initiierung von entsprechenden Projekten, Programmen und Ausstellungen.
Ein Beispiel für ein gelungenes Inklusionsprojekt abseits der Institution Museum stellte Heidi Fischer, Leiterin des Instituts für soziale Berufe (IfsB), anschließend vor. Seit nunmehr acht Jahren lädt das IfsB gemeinsam mit dem Inklusiven Atelier des ZfP Südwürttemberg zum Kunst- und Musikprojekt ein. Die jedes Jahr rund 45 Teilnehmenden setzen sich zusammen aus Menschen aus dem Kontext Psychiatrie und dem Sozialraum Ravensburg sowie aus Studierenden des ersten IfsB-Ausbildungsjahrgangs.
Dabei sei es schön zu beobachten, wie sich Kommunikation und Teamarbeit über das gemeinsame musikalische und künstlerische Gestalten entwickle. Nicht von Beginn an, sondern als Prozess über die Projektphasen hinweg. „Die anfängliche Anspannung weicht einer Offenheit, die diese beiden Wochenenden immer zu etwas ganz Besonderem macht.“ Die eingesetzten Medien – Instrumente, Materialien, Werkzeuge - dienten darin als Anlass zur offenen, vorurteilsfreien Begegnung in einem geschützten Setting. Fischer resümierte: „Es geht letztlich um eine Ent-Hinderung mithilfe der Kunst – wir müssen irritationsfähig werden, damit Inklusion gelingen kann.“
„Art brut, Outsider-Art, Betroffenen-Kunst – kann man nicht einfach alles nur Kunst nennen?“, fragte PD Dr. phil. Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn am Universitätsklinikum Heidelberg, zum Einstieg in seinen Vortrag. Anschließend zeichnete er die Entstehung der Begrifflichkeiten nach: die Art brut als „Kunst des gemeinen Mannes“, die Outsider-Art als Bezeichnung für Werke „außerhalb der Kunst, aber nicht außerhalb der Gesellschaft“ und inwiefern das eine als kommerzialisierte Form des anderen anzusehen ist. „Kunst ist kein neutraler Begriff. Es gibt bestimmte Regeln, die es einzuhalten gilt, damit ein Werk als ‚Kunst‘ angesehen und auch entsprechend als solche präsentiert wird.“ Röske stellte die Frage in den Raum, inwieweit der Begriff damit zu einem Marker für Ausgrenzung geworden ist.
Im Weiteren zeigte er beispielhaft die Probleme des Museumsbetriebs mit Werken von „am Rande der Gesellschaft Stehenden“ auf. Dabei warf er einen auch selbstkritischen Blick auf die räumliche Beschaffenheit von Ausstellungsorten – Stichwort „White Cube“ – und auf die angemessene (Nicht-)Rahmung des Gezeigten. „Wir werten die Dinge als Kunst auf, was nicht immer richtig erscheint.“ Er machte deutlich, wie schwer es so manchen Ausstellungsmachern offensichtlich fällt, die Werke und deren Autoren auf eine Weise zu präsentieren, die ihnen gerecht wird: Teils sei eine „entwürdigende Hängung“ realisiert, teils werde in der dem Werk zur Seite gestellten Biografie deutlich zwischen „echten“ Künstlern und zum Beispiel „Psychiatrieerfahrenen“ unterschieden. Röske stellte aber auch positive Beispiele vor, die ihn zu dem Fazit führten: „Wir haben noch viel zu tun, aber ich habe Hoffnung.“